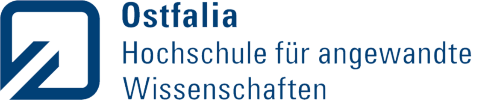Bitte schauen Sie regelmäßig in den Lehrveranstaltungsplan (wö. Darstellung), da es auch zu kurzfristigen Änderungen / Aktualisierungen / Ausfällen im laufenden Semester kommen kann.
Lehrveranstaltungen im Sommersemester
Master PSA 2. Semester SS 2025-Stand 06.05.2025
2. Semester Lehrveranstaltungsplan Schwerpunkt 1 (wö. Darstellung)
2. Semester Lehrveranstaltungsplan Schwerpunkt 2 (wö. Darstellung)
Master PSA 4. Semester SS 2025-Stand 10.03.2025
4. Semester Lehrveranstaltungsplan Schwerpunkt 1 (wö. Darstellung)
4. Semester Lehrveranstaltungsplan Schwerpunkt 2 (wö. Darstellung)
Lehrveranstaltungen im Wintersemester
Master PSA 1. Semester WS 2025/26-Stand 30.06.2025
1. Semester Lehrveranstaltungsplan Schwerpunkt 1 (wö. Darstellung)
1. Semester Lehrveranstaltungsplan Schwerpunkt 2 (wö. Darstellung)
Master PSA 3. Semester WS 2025/26-Stand 30.06.2025
3. Semester Lehrveranstaltungsplan Schwerpunkt 1 (wö. Darstellung)
3. Semester Lehrveranstaltungsplan Schwerpunkt 2 (wö. Darstellung)