The Dynamic Digital Resilience for Medical and Allied Professions in Health Services
(DDS-MAP)
Das Projekt „Dynamic Digital Resilience for Medical and Allied Professions in Health Services“ –
kurz DDS-Map – unter der Gesamtkoordination der irischen Universität „South East Technological
University“ hat sich zum Ziel gesetzt, ein Qualifizierungsangebot für Angehörige von
Gesundheitsberufen und verwandter Berufe in der Europäischen Union zu entwickeln, das sich auf den
Erwerb und die Beherrschung neuer digitaler Technologien bei der Erbringung von
Versorgungsleistungen konzentriert.
Aktuelles:
Call-to-Action – Einladung zur kostenfreien Pilotphase der
DDS-Weiterbildungsmodule
Neue Technologien. Wachsende Anforderungen. Immer komplexere Prozesse. Und keine Zeit, sich über
die steigenden Herausforderungen im Gesundheitswesen zu informieren oder sich mit ihnen
auseinanderzusetzen?
Dann könnten die vier entwickelten DDS-MAP-Weiterbildungsmodule genau das Richtige sein!
Die vier Weiterbildungsmodule:
- (Grundlegende) digitale Kompetenzen im Gesundheitswesen
- Aktuelle und entstehende Herausforderungen im Gesundheitswesen
- Implementierung eines digitalen Gesundheitswesens
- Train the Trainer – Aufbau von persönlichem Wohlbefinden von Gesundheitsfachberufen
(Führungskräfteentwicklung)
Diese Module wurden im Rahmen des Forschungsprojekts DDS-Map (Link:
https://ddsmap.easpd.eu/de/) auf Basis einer europaweiten
Umfrage zur subjektiven Einschätzung im Umgang mit digitalen Tools entwickelt.
Jetzt ist
Euer / Ihr Feedback gefragt!
Anmeldung zur kostenfreien Pilotphase: Es ist möglich, zwischen den vier
entwickelten Modulen zu wählen und das auszusuchen, welches Euch/Sie am meisten anspricht.
Von
Ende März bis Mitte Juni habt Ihr/Sie jeweils
4–6 Wochen Zeit, um auf der Lernplattform
Moodle die E-Lernmaterialien online zu bearbeiten. Innerhalb jedes Moduls findet
zudem ein
LIVE-Webinar statt.
Des Weiteren werden im April, Mai und Juni Präsenztermine an der Fakultät Gesundheitswesen an
der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfsburg angeboten, um entwickelte
VR-Sequenzen über ein VR-Headset und den Prototypen eines
digitalen Zwillings eines Krankenhauses
auszuprobieren und näher zu betrachten. Es kann zwischen verschiedenen
Terminvorschlägen gewählt werden.
⚠️
Wichtiger Hinweis: Im
Modul 2 ist der Präsenztermin verpflichtend, um das Modul abzuschließen. In allen
anderen Modulen ist die Teilnahme optional.
Geplante Präsenztermine im Rahmen von ca. 4 - 5 Zeitstunden (inkl. Pause):
10.04.
09.05.
12.06.
(Weitere Informationen und Abstimmungen zu den geplanten Präsenzterminen folgen innerhalb der
Module.)
Nach Abschluss des Moduls erhaltet
Ihr/Sie einen digitalen Badge / Nachweis, dass Ihr/Sie an einem (oder mehreren)
DDS-Map-Modulen teilgenommen habt/haben. Diesen digitalen Badge könnt Ihr/Sie z. B. in Eurem/ Ihrem
LinkedIn-Profil hinterlegen, um Eure / Ihre neu erworbenen Kompetenzen sichtbar zu machen.
Hier könnt Ihr einen Blick auf die Modulinhalte werfen und Euch anmelden:
Die Module können unabhängig voneinander bearbeitet werden und bauen nicht aufeinander auf. Zur
Orientierung haben wir eine
Entscheidungshilfe erstellt, die Euch / Sie dabei unterstützt, das passende Modul
basierend auf Euren / Ihren bestehenden Kenntnissen und Kompetenzen auszuwählen.
Die Entscheidungshilfe kann hier heruntergeladen werden:
https://sync.academiccloud.de/index.php/s/heujL2u1sE5nwAm
Bei weiteren Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Jetzt anmelden & loslegen!
Ansprechpartnerinnen: Stephanie Krebs und Martina Hasseler
✉️
dds-map-g@ostfalia.de
(Bitte teilt / teilen Sie uns bei Anmeldung Ihren Vor- und Nachnamen, eine
E-Mail-Adresse, (unter der Sie erreichbar sind) und Eure/ Ihre organisatorische Rolle / Funktion im
Gesundheitssektor mit. Diese Daten werden ausschließlich zu organisatorischen Zwecken erhoben und
werden weder in die Evaluation des Forschungsprojekts einbezogen noch an Dritte
weitergegeben.)
Background
COVID-19 and war in Ukraine are harbingers of a more destabilised world driven by climate
change, rapid mass migration, food insecurity, state failures and epidemics. These events will
heavily affect Europe’s health systems’ infrastructure and health workforce. On the other hand,
health care professionals often lack sufficient knowledge, training, and skills to engage
effectively with digital technologies. As a result, they are often stressed when dealing with these
technologies. Aiming to address the challenges arising from the wide use of digital and electronic
technologies in the multi-disciplinary health care environment across the EU, the DDS-MAP formed a
Pan-European consortium consisting of HEIs (Medical, Nursing, Education and Digital Technology),
NGOs, health authorities and health insurers across the EU.
General objective
The
EU4Health ‘DDS-MAP’ project aims to develop new training provision for healthcare and
allied professionals in the EU, focused on the acquisition and mastery of new digital technologies
in the delivery of care services. Healthcare professionals’ awareness, knowledge, and
self-reflection on their use of digital technologies will be explored in both learning and
professional practice.
Specific objectives
- Map the provision of available digital skills (literacy, digital transformation, cybersecurity,
online communication) of the health workforce at local and European level to increase digital
competency of healthcare workers.
- Enable healthcare managers to better respond to current and emerging healthcare issues
(cybersecurity, surge management, supply management).
- Enable healthcare workers to effectively plan, deliver, monitor, and evaluate digital health
care approaches and their well-being and resilience through adaptation of digital skills.
- Engage with regulatory authorities and professional associations to promote micro learning and
credentials accreditation for the acquisition and recognition of digital skills.
Results
Over the next 30 months the project will produce -
- A first-of-its-kind survey of the digital competences across the European Union.
- European training modules developed through a co-creation process, addressing the needs of
multiple disciplines for hospital doctors, nurses, and non-clinical staff.
- Micro credentials leveraging and adapting an established framework for DDS-MAP.
- Augmented and virtual reality (AR and VR) platform leveraging expertise within DDS-MAP.
Partnership
Partners are South East Technological University (Co-ordinator), IBK Management Solutions
(Germany), University College Dublin (Ireland), University of Maribor (Slovenia), Ostfalia
University of Applied Sciences (Germany), University of Udine (Italy), Klaipedos University
(Lithuania), University of Osijeck, (Croatia), Medical University Lublin (Poland), Association of
Knowledge and Technology Industries – GAIA (Spain), Health Authority Teramo – ASL (Italy), European
Association of Service Providers for People with Disabilities (Belgium), EUROFORTIS Society
(Latvia), Mutualia Mutual Social Security Collaboration (Spain), Riga Stadina University
(Latvia).
Funding
DDS-MAP has funding worth €2,477,703.77 of which €1,982, 000 is provided under the European
Union’s EU4Health programme under grant agreement no – 101101259.
Das Projekt ist im März 2023 gestartet und wird von Frau Prof. Hasseler und Stephanie Krebs
an der Fakultät Gesundheitwesen durchgeführt. Weitere Informationen können der
Projekthomepage entnommen werden:
Bei Fragen zum Projekt stehen Ihnen Frau Stephanie Krebs oder Frau Prof. Hasseler unter der
E-Mailadresse des Projekts
dds-map-g@ostfalia.de gerne zur Verfügung.
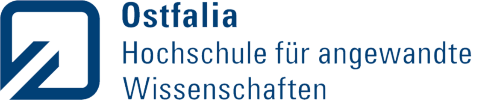














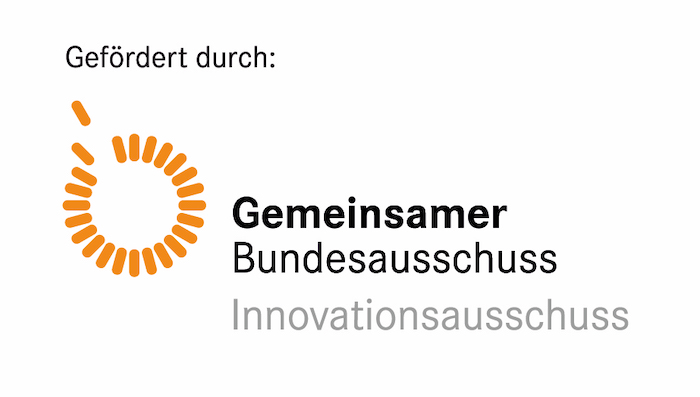



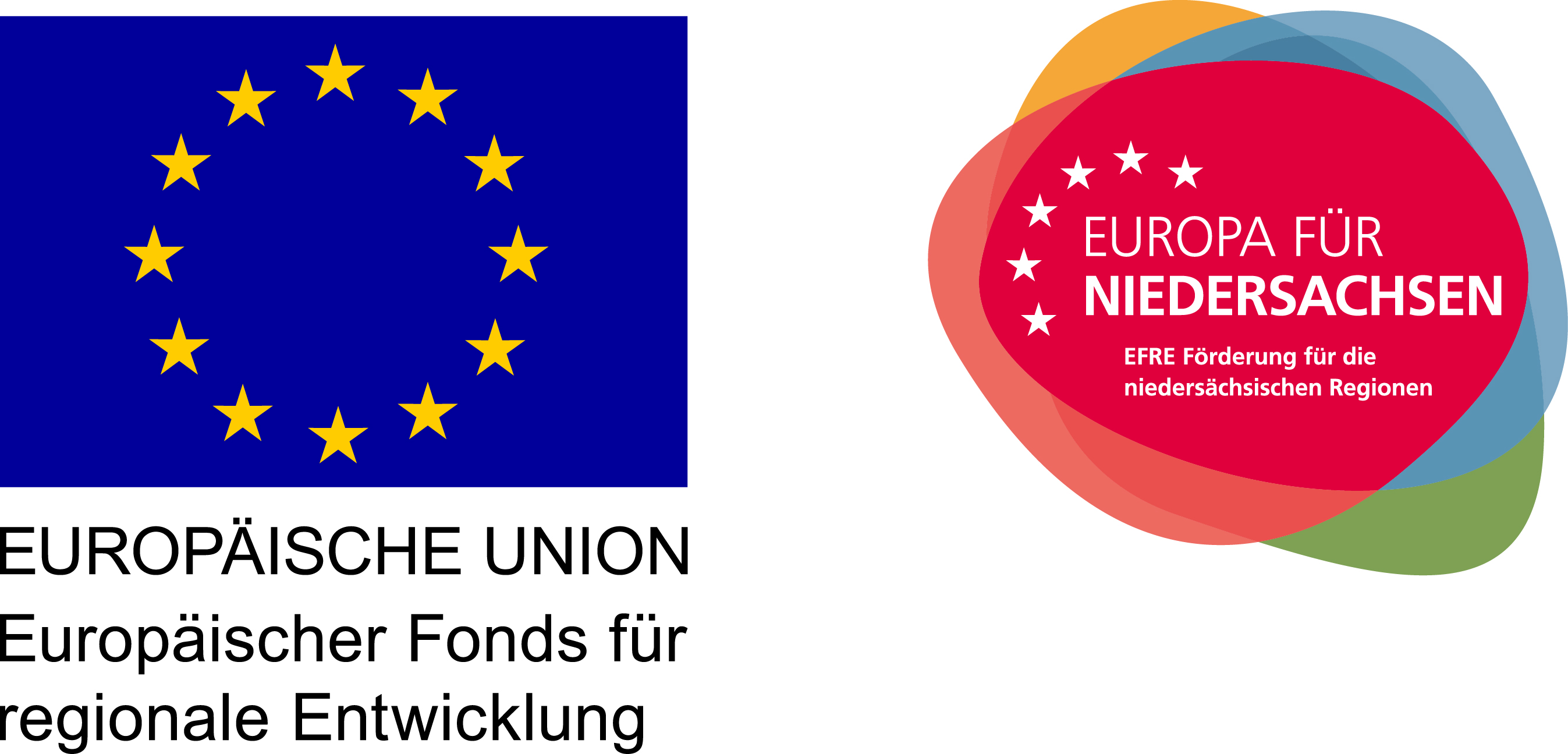


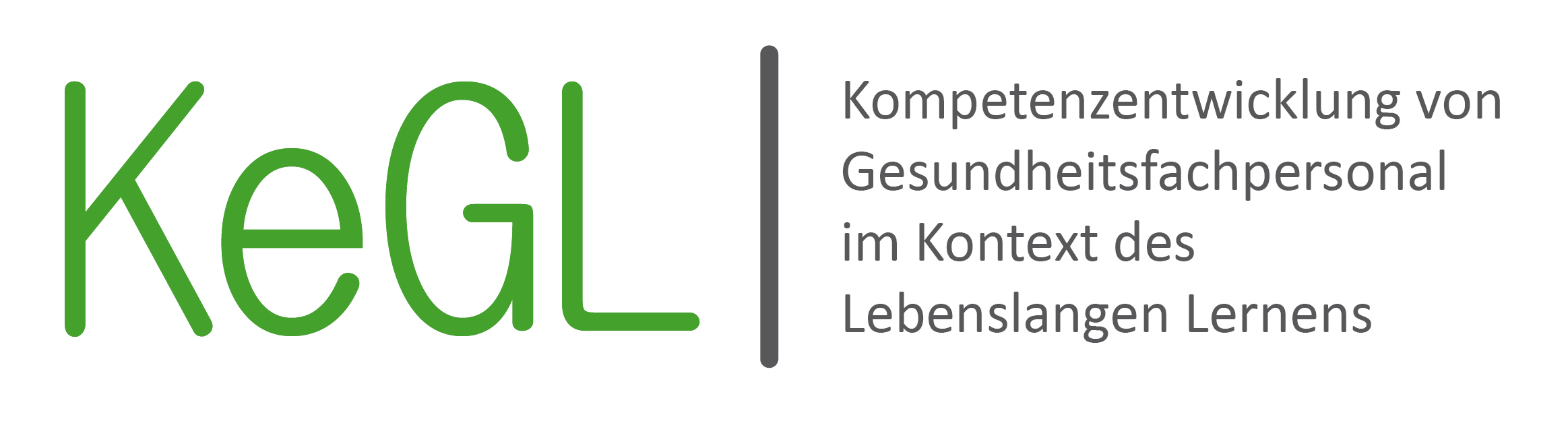



Auftraggeber
Das Projekt wird als Auftragsforschung für das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) durchgeführt.
Nähere Informationen sind auf der Projekt-Website zu finden.